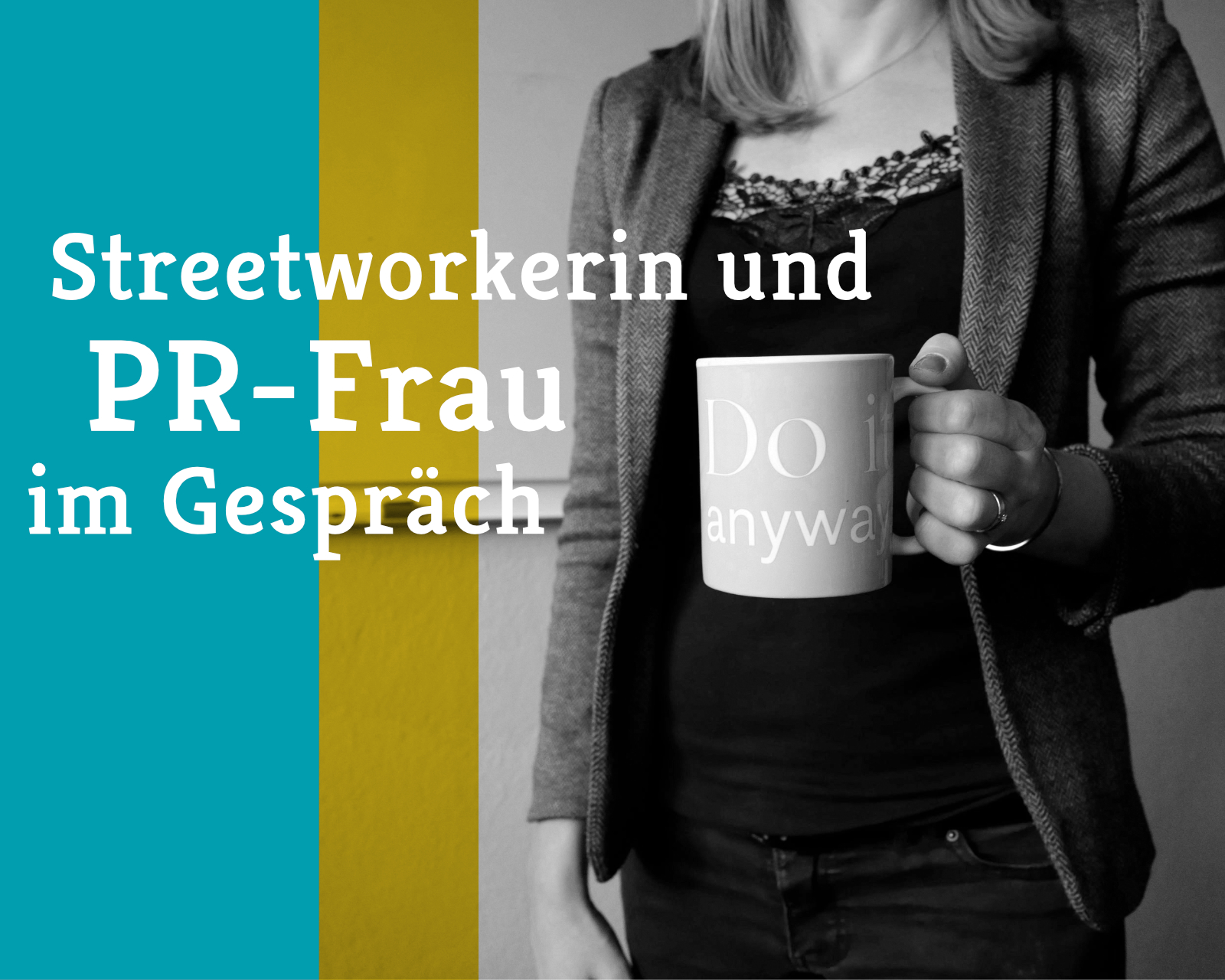Hannes Wolf, ehrenamtlicher Vorsitzender des Berliner Landesverbands für Soziale Arbeit e. V. (DBSH)
Empowerment durch Austausch: Wenn Soziale Arbeit und Journalist*innen zusammenkommen
In der Öffentlichkeitsarbeit Sozialer Arbeit gibt es einen Klassiker: Die »Bergneustädter Gespräche«, vor über 50 Jahren entstanden. Damals trafen Expert*innen aus Sozialer Arbeit und Journalismus aufeinander, um Barrieren abzubauen und Leitlinien für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln. Hannes Wolf ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Berliner Landesverbands des Deutschen Berufsverbands für Soziale Arbeit (DBSH). Auch er hat Erfahrung als Vermittler zwischen Journalist*innen und Sozialarbeiter*innen. Welche Relevanz hat für ihn der Austausch zwischen den Professionen heute, in einer digitalen Zeit?
Hannes, bei den »Bergneustädter Gesprächen« vor 50 Jahren muss heiß diskutiert worden sein. Die Texte dazu lesen sich, als wären damals zwei Fronten aufeinandergeprallt. Woher kommt eigentlich die Skepsis von Sozialarbeiter*innen gegenüber »der Presse«?
Hannes Wolf: Gute Frage, diese Skepsis begegnet mir auch. Gleichzeitig erlebe ich in der Sozialen Arbeit auch immer wieder eine Unbedarftheit, wenn es um Pressearbeit geht. Wir haben oft ein vorgefertigtes Bild gegenüber anderen Professionen. Das kann sich nur ändern, wenn wir uns damit aktiv auseinandersetzen.
Du organisierst für den DBSH immer wieder Workshops, bei denen Journalist*innen und Sozialarbeitende zusammenkommen. Was hörst du da, was sind die großen Fragen von Sozialarbeiter*innen, wenn es um Pressearbeit geht?
Hannes Wolf: Zum einen wird oft der rechtliche Rahmen thematisiert: »Was darf ich sagen? Was erlaubt mein Arbeitgeber? Wozu bin ich befugt? Und: Wieviel Kontrolle habe ich darüber, wie mein Input im Artikel schließlich dargestellt wird?« Das ist besonders für Sozialarbeiter*innen wichtig, die in Behörden arbeiten. Dort kann Pressearbeit als bedrohlich wahrgenommen werden, weil die öffentliche Wahrnehmung Wahlen beeinflusst. Häufig dürfen Sozialarbeiter*innen gar nichts an die Presse »herausgeben«, ohne formale Wege zu gehen. Zweitens geht es oft darum, wie Klient*innen dargestellt werden: »Werden die Menschen als Opfer dargestellt? Wird in den Medien emotionalisiert und dramatisiert?«
Was ist deine Antwort darauf?
Hannes Wolf: Ich ermutige die Kolleg*innen, nicht pauschal abzuwehren und zu sagen: »Wir sprechen nicht mit der Presse«, aus Angst, etwas falsch zu machen. Sondern sich viel mehr der eigenen Rolle bewusst zu werden und einen professionellen Umgang auszutesten. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Kommunikation im Journalismus einfach eine andere ist als in der Wissenschaft! In der Pressearbeit braucht es das Konkretwerden, Geschichten erzählen. Da sträubt man sich in der Sozialen Arbeit, weil wir in unserer Ausbildung gelernt haben, dass immer größere, strukturelle Probleme hinter den Herausforderungen von Einzelnen stehen, und wir tun uns schwer damit, persönliche Einzelschicksale zu erzählen. »Das kann man doch nicht verallgemeinern!«, heißt es dann. Damit ist die Soziale Arbeit aber nicht allein: Jede Profession steht in ihrer Kommunikation nach außen vor der Herausforderung, Komplexität zu reduzieren, ohne für das eigene Fachpublikum banal zu wirken!
Aus der fachlichen Sicht der Sozialen Arbeit müssten die meisten Geschichten in einen größeren Rahmen eingebettet werden. Journalisten sagen dazu allerdings: »Das ist unser Job, wir sind diejenigen, die recherchieren und schreiben. Ihr könnt uns unterstützen, wenn Ihr Informationen und Geschichten vermittelt und uns helft, Fakten zu prüfen.
Was verändert sich durch eure Workshops im DBSH?
Ich sehe sie als eine Art Empowerment. Für den ersten Workshop dieser Art hatte ich vor einigen Jahren im Rahmen eines Fachtages für Kolleg*innen der Berliner Jugendämtern eine Journalistin der TAZ eingeladen, uns zu erzählen, wie sie arbeitet. Das hat viel bewirkt, die Kolleg*innen sind im Umgang mit der Presse souveräner geworden. Das war damals ein Workshop mit 20, 30 Leuten. Die Erfahrung hat sich geradezu verselbständigt, die Teilnehmer*innen sind dann losgezogen, aktiv auf die Presse zugegangen, haben daraus gelernt und ihre Erfahrungen weitererzählt.
Natürlich hingen die Erfolge davon ab, wie die Lokalpolitik in den einzelnen Berliner Bezirken darauf reagierten: Es gibt Jugendamtsleitungen und Stadträte, die die aktive Pressearbeit förderten – und solche, die Druck ausübten. So bekamen wir aus einzelnen Bezirken ganz unterschiedliche Berichterstattungen. In manchen Bezirken aus der Perspektive der Jugendamtsleitungen und Stadträt*innen, in anderen Bezirken aber auch aus Sicht der Sozialen Arbeit selbst.
Sind die Erfolge unterschiedlich, je nach Arbeitsbereich?
Hannes Wolf: Natürlich. Es macht es einen großen Unterschied, ob ich in einer Behörde oder bei einem freien Träger arbeite. Mein Eindruck ist, dass gerade viele kleinere Träger der Sozialen Arbeit ein sehr selbstverständliches Auftreten gegenüber der Presse haben – weil viele sich über Spenden finanzieren und darin geübt sind, für ihre Zielgruppen gezielt Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, auch über eigene Kanäle. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn ich zum Beispiel in einer Behörde arbeite und mit kritischen Nachfragen von Journalist*innen umgehen oder auf Krisenkommunikation vorbereitet sein muss.
Hannes, bei den »Bergneustädter Gesprächen« vor 50 Jahren muss heiß diskutiert worden sein. Die Texte dazu lesen sich, als wären damals zwei Fronten aufeinandergeprallt. Woher kommt eigentlich die Skepsis von Sozialarbeiter*innen gegenüber »der Presse«?
Hannes Wolf: Gute Frage, diese Skepsis begegnet mir auch. Gleichzeitig erlebe ich in der Sozialen Arbeit auch immer wieder eine Unbedarftheit, wenn es um Pressearbeit geht. Wir haben oft ein vorgefertigtes Bild gegenüber anderen Professionen. Das kann sich nur ändern, wenn wir uns damit aktiv auseinandersetzen.
Du organisierst für den DBSH immer wieder Workshops, bei denen Journalist*innen und Sozialarbeitende zusammenkommen. Was hörst du da, was sind die großen Fragen von Sozialarbeiter*innen, wenn es um Pressearbeit geht?
Hannes Wolf: Zum einen wird oft der rechtliche Rahmen thematisiert: »Was darf ich sagen? Was erlaubt mein Arbeitgeber? Wozu bin ich befugt? Und: Wieviel Kontrolle habe ich darüber, wie mein Input im Artikel schließlich dargestellt wird?« Das ist besonders für Sozialarbeiter*innen wichtig, die in Behörden arbeiten. Dort kann Pressearbeit als bedrohlich wahrgenommen werden, weil die öffentliche Wahrnehmung Wahlen beeinflusst. Häufig dürfen Sozialarbeiter*innen gar nichts an die Presse »herausgeben«, ohne formale Wege zu gehen. Zweitens geht es oft darum, wie Klient*innen dargestellt werden: »Werden die Menschen als Opfer dargestellt? Wird in den Medien emotionalisiert und dramatisiert?«
Was ist deine Antwort darauf?
Hannes Wolf: Ich ermutige die Kolleg*innen, nicht pauschal abzuwehren und zu sagen: »Wir sprechen nicht mit der Presse«, aus Angst, etwas falsch zu machen. Sondern sich viel mehr der eigenen Rolle bewusst zu werden und einen professionellen Umgang auszutesten. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Kommunikation im Journalismus einfach eine andere ist als in der Wissenschaft! In der Pressearbeit braucht es das Konkretwerden, Geschichten erzählen. Da sträubt man sich in der Sozialen Arbeit, weil wir in unserer Ausbildung gelernt haben, dass immer größere, strukturelle Probleme hinter den Herausforderungen von Einzelnen stehen, und wir tun uns schwer damit, persönliche Einzelschicksale zu erzählen. »Das kann man doch nicht verallgemeinern!«, heißt es dann. Damit ist die Soziale Arbeit aber nicht allein: Jede Profession steht in ihrer Kommunikation nach außen vor der Herausforderung, Komplexität zu reduzieren, ohne für das eigene Fachpublikum banal zu wirken!
Aus der fachlichen Sicht der Sozialen Arbeit müssten die meisten Geschichten in einen größeren Rahmen eingebettet werden. Journalisten sagen dazu allerdings: »Das ist unser Job, wir sind diejenigen, die recherchieren und schreiben. Ihr könnt uns unterstützen, wenn Ihr Informationen und Geschichten vermittelt und uns helft, Fakten zu prüfen.
Was verändert sich durch eure Workshops im DBSH?
Hannes Wolf: Ich sehe sie als eine Art Empowerment. Für den ersten Workshop dieser Art hatte ich vor einigen Jahren im Rahmen eines Fachtages für Kolleg*innen der Berliner Jugendämtern eine Journalistin der TAZ eingeladen, uns zu erzählen, wie sie arbeitet. Das hat viel bewirkt, die Kolleg*innen sind im Umgang mit der Presse souveräner geworden. Das war damals ein Workshop mit 20, 30 Leuten. Die Erfahrung hat sich geradezu verselbständigt, die Teilnehmer*innen sind dann losgezogen, aktiv auf die Presse zugegangen, haben daraus gelernt und ihre Erfahrungen weitererzählt.
Natürlich hingen die Erfolge davon ab, wie die Lokalpolitik in den einzelnen Berliner Bezirken darauf reagierten: Es gibt Jugendamtsleitungen und Stadträte, die die aktive Pressearbeit förderten – und solche, die Druck ausübten. So bekamen wir aus einzelnen Bezirken ganz unterschiedliche Berichterstattungen. In manchen Bezirken aus der Perspektive der Jugendamtsleitungen und Stadträt*innen, in anderen Bezirken aber auch aus Sicht der Sozialen Arbeit selbst.
Sind die Erfolge unterschiedlich, je nach Arbeitsbereich?
Hannes Wolf: Natürlich. Es macht es einen großen Unterschied, ob ich in einer Behörde oder bei einem freien Träger arbeite. Mein Eindruck ist, dass gerade viele kleinere Träger der Sozialen Arbeit ein sehr selbstverständliches Auftreten gegenüber der Presse haben – weil viele sich über Spenden finanzieren und darin geübt sind, für ihre Zielgruppen gezielt Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, auch über eigene Kanäle. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn ich zum Beispiel in einer Behörde arbeite und mit kritischen Nachfragen von Journalist*innen umgehen oder auf Krisenkommunikation vorbereitet sein muss.
Bergneustädter Gespräche, neu gedacht: zwischen klassischer Pressearbeit und digitalem Marketing
Bei den Bergneustädter Gesprächen vor 50 Jahren wurde Öffentlichkeitsarbeit in der Sozialen Arbeit quasi mit »Pressearbeit« gleichgesetzt. Angenommen, wir würden das Format heute wiederholen: Würden wir immer noch Journalist*innen einladen? Und wären auch Blogger*innen, Social-Media-Manager*innen und Online-Marketing-Expert*innen dabei?
Hannes Wolf: Ich denke, es braucht beides: die klassische Pressearbeit einerseits und andererseits auch das eigene Marketing, das heute immer stärker ins Digitale geht. Bei den Bergneustädter Gesprächen vor 50 Jahren war das Bewusstsein in der Sozialen Arbeit noch gar nicht da, dass wir überhaupt ein eigenes Marketing als Profession betreiben müssen, um sichtbar zu sein.
Das ist heute viel stärker. Einige Autor*innen haben seither Öffentlichkeitsarbeit als eigene, notwendige Handlungsmethode der Sozialen Arbeit definiert. Gerade in der Gemeinwesenarbeit schwingt das immer mit. In den 90er-Jahren haben viele Hochschulen die Öffentlichkeitsarbeit in ihre Lehrpläne für angehende Sozialarbeiter*innen aufgenommen. Ich habe selbst als Student an solchen Seminaren teilgenommen, wenn auch meistens im Wahlpflichtbereich.
Wie Menschen mit Medien umgehen, hat sich verändert. Vor rund einem Jahr (Anm. 2020) haben wir beim DBSH hat die Kampagne #dauerhaft.systemrelevant gestartet. Noch bevor wir die erste Pressemitteilung herausgegeben hatten, gab es ein Social-Media-Team! Auf eigene soziale Kanäle zu setzen, ist attraktiv, denn du hast hier die Kontrolle über deine Inhalte. Andererseits ist nach wie vor der politische Diskurs über die Presse und die Massenmedien beeinflusst. Insofern: Wenn wir die Bergneustädter Gespräch heute wiederholen würden, wären daher sicherlich Expert*innen für digitales Marketing und digitale Kommunikation dabei, aber nach wie vor auch Journalist*innen.
Mut zum Unperfekten: Wie digitale Kommunikation den Berufsverband für Soziale Arbeit prägt
#dauerhaft systemrelevant ist die erste digitale Kampagne des DBSH. Was lernt ihr da gerade, was verändert sich im DBSH?
Hannes Wolf: Ich habe zum Beispiel letztes Jahr gelernt, dass man Journalist*innen statt der klassischen PR auch einfach antwittern kann – und zwar erfolgreich! Dennoch brauchen Journalist*innen für ihre Recherche im Hintergrund dann doch wieder Zahlen, Daten, Fakten, um den »Tweet« ins große Ganze einzuordnen. Dafür müssen wir nach wie vor als Verband für eine Kampagne wie #dauerhaft systemrelevant konkrete Forderungen ausarbeiten und bereitstellen.
Unsere These ist: Wir punkten in den Sozialen Medien mit kurzen, emotionalen Geschichten darüber, wie Soziale Arbeit unter Corona-Bedingungen gelingt oder misslingt, und machen dadurch auch die Presse auf uns aufmerksam. Im Hintergrund machen wir nach wie vor klassische Pressearbeit. Wir brauchen beides, um unsere strategischen Ziele zu erreichen.
Ergänzen digitale und soziale Medien die Kommunikation des DBSH nur – oder verändert sie sich völlig?
Da bin ich mir noch nicht sicher: Sind die Sozialen Medien einfach ein weiterer Zugang, um sichtbar zu bleiben und den Weg zu unserer klassischen Verbandskommunikation zu öffnen? Oder müssen wir in unserer gesamten Kommunikation emotionaler werden, weil wir es heute durch soziale und digitale Medien so gewohnt sind?
Bei uns im Verband gibt es darüber gerade viel Reflexion und Auseinandersetzung: Wer wollen wir eigentlich sein? Über Jahre hinweg sind die Professionalisierung und die Berufsethik die dominierenden Themen der Sozialen Arbeit gewesen. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu einer strukturierten, strategischen Kommunikation. Das ist ein laufender Prozess. Man muss bedenken, wir machen das alle ehrenamtlich! Ursprünglich hatte der Verband einmal die Fachzeitschrift Forum Sozial gewählt, um Informationen aus dem Verband und Fachinformationen an die Mitglieder und die Öffentlichkeit zu transportieren. Jetzt gibt es den Wunsch zu untersuchen: Wie digitalisieren wir das Ganze? Ergänzen wir die Print-Variante durch ein Onlinemagazin? Oder gehen wir so vor, dass wir den ein oder anderen Fachartikel auch mal online teilen?
Wir haben teilweise vor drei Jahren Artikel in Zeitschriften veröffentlicht, die immer noch aktuell sind – aber die sucht sich ja heute keiner mehr heraus, wenn sie nicht digital sind. All diese Zukunftsfragen müssen wir jetzt angehen.
Verändern sich auch die Arbeitsweisen des DBSH durch die digitale Kampagne?
Wir sind gerade viel mutiger als sonst! Es wird nicht jeder Social Media Post dreimal gegengecheckt, sondern bei #dauerhaft systemrelevant können sich kompetente Menschen einfach unkompliziert einbringen, an allen Strukturen vorbei.
Nicht alles ist perfekt. Aber in den digitalen Medien kann man Fehler auch schnell korrigieren. Insofern ist die Kampagne sehr durchlässig und es sind viele Kolleg*innen dabei, die sich zum ersten Mal beim DBSH einbringen. Man muss nicht Mitglied sein, um teilzunehmen. Alles was man tun muss ist, sich montagabends vor den Laptop setzen und sich so sehr einbringen wie man möchte. Wir nutzen erstmals als Verband auch kollaborative Tools, die die Zusammenarbeit fördern. Die Leute schulen sich gegenseitig online und vermitteln einander neue Kompetenzen.
Hier sind wir in einem Entwicklungsprozess, genauso wie viele andere Organisationen und Unternehmen, die durch den Lockdown plötzlich anders arbeiten. Vielleicht brauchten wir diesen Schubs, um neue Arbeitsformen zu entdecken. Ohne die kann kreative, lebendige Kommunikation vielleicht heute gar nicht gelingen.
#dauerhaft systemrelevant ist die erste digitale Kampagne des DBSH. Was lernt ihr da gerade, was verändert sich im DBSH?
Hannes Wolf: Ich habe zum Beispiel letztes Jahr gelernt, dass man Journalist*innen statt der klassischen PR auch einfach antwittern kann – und zwar erfolgreich! Dennoch brauchen Journalist*innen für ihre Recherche im Hintergrund dann doch wieder Zahlen, Daten, Fakten, um den »Tweet« ins große Ganze einzuordnen. Dafür müssen wir nach wie vor als Verband für eine Kampagne wie #dauerhaft systemrelevant konkrete Forderungen ausarbeiten und bereitstellen.
Unsere These ist: Wir punkten in den Sozialen Medien mit kurzen, emotionalen Geschichten darüber, wie Soziale Arbeit unter Corona-Bedingungen gelingt oder misslingt, und machen dadurch auch die Presse auf uns aufmerksam. Im Hintergrund machen wir nach wie vor klassische Pressearbeit. Wir brauchen beides, um unsere strategischen Ziele zu erreichen.
Ergänzen digitale und soziale Medien die Kommunikation des DBSH nur – oder verändert sie sich völlig?
Hannes Wolf: Da bin ich mir noch nicht sicher: Sind die Sozialen Medien einfach ein weiterer Zugang, um sichtbar zu bleiben und den Weg zu unserer klassischen Verbandskommunikation zu öffnen? Oder müssen wir in unserer gesamten Kommunikation emotionaler werden, weil wir es heute durch soziale und digitale Medien so gewohnt sind?
Bei uns im Verband gibt es darüber gerade viel Reflexion und Auseinandersetzung: Wer wollen wir eigentlich sein? Über Jahre hinweg sind die Professionalisierung und die Berufsethik die dominierenden Themen der Sozialen Arbeit gewesen. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu einer strukturierten, strategischen Kommunikation. Das ist ein laufender Prozess. Man muss bedenken, wir machen das alle ehrenamtlich! Ursprünglich hatte der Verband einmal die Fachzeitschrift Forum Sozial gewählt, um Informationen aus dem Verband und Fachinformationen an die Mitglieder und die Öffentlichkeit zu transportieren. Jetzt gibt es den Wunsch zu untersuchen: Wie digitalisieren wir das Ganze? Ergänzen wir die Print-Variante durch ein Onlinemagazin? Oder gehen wir so vor, dass wir den ein oder anderen Fachartikel auch mal online teilen?
Wir haben teilweise vor drei Jahren Artikel in Zeitschriften veröffentlicht, die immer noch aktuell sind – aber die sucht sich ja heute keiner mehr heraus, wenn sie nicht digital sind. All diese Zukunftsfragen müssen wir jetzt angehen.
Verändern sich auch die Arbeitsweisen des DBSH durch die digitale Kampagne?
Hannes Wolf: Wir sind gerade viel mutiger als sonst! Es wird nicht jeder Social Media Post dreimal gegengecheckt, sondern bei #dauerhaft systemrelevant können sich kompetente Menschen einfach unkompliziert einbringen, an allen Strukturen vorbei.
Nicht alles ist perfekt. Aber in den digitalen Medien kann man Fehler auch schnell korrigieren. Insofern ist die Kampagne sehr durchlässig und es sind viele Kolleg*innen dabei, die sich zum ersten Mal beim DBSH einbringen. Man muss nicht Mitglied sein, um teilzunehmen. Alles was man tun muss ist, sich montagabends vor den Laptop setzen und sich so sehr einbringen wie man möchte. Wir nutzen erstmals als Verband auch kollaborative Tools, die die Zusammenarbeit fördern. Die Leute schulen sich gegenseitig online und vermitteln einander neue Kompetenzen.
Hier sind wir in einem Entwicklungsprozess, genauso wie viele andere Organisationen und Unternehmen, die durch den Lockdown plötzlich anders arbeiten. Vielleicht brauchten wir diesen Schubs, um neue Arbeitsformen zu entdecken. Ohne die kann kreative, lebendige Kommunikation vielleicht heute gar nicht gelingen.
Dialogfähig und klar sein: Auf dem Weg zur Markensprache der Sozialen Arbeit
Hinter #dauerhaft systemrelevant steht auch die Überlegung, wie Soziale Arbeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden soll. Wie weit seit ihr in diesem Prozess?
Hannes Wolf: Noch ziemlich am Anfang. Das hängt auch damit zusammen, dass der DBSH rein ehrenamtlich organisiert ist. Wir haben wenig Ressourcen für Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit und kommunizieren viel öfter reaktiv, als uns proaktiv mit Themen an die Öffentlichkeit zu wenden.
Es ist aber tatsächlich ein Ziel der Kampagne, unsere Corporate Identity als Profession weiterzuentwickeln. Dafür gilt es, zu klären, welches Bild von Sozialer Arbeit wir in den nächsten Jahren zeichnen wollen. Aktuell laufen wir da in zu viele Richtungen gleichzeitig. Eine wesentliche Frage ist: Welches Bild von Sozialer Arbeit vermitteln wir Politik und Verwaltung gegenüber? Wollen wir die »moderierende Fachexpertise« sein? Oder politisches Sprachrohr im Sinne von »Kampfrhetorik«. Wie man kommuniziert, so wird man wahrgenommen.
Manche Unternehmen entwickeln im Zuge einer »Corporate Identity« auch eine eigene Markensprache. Auf welchen Werten müsste eine Markensprache der Sozialen Arbeit aufbauen? Welchen Charakter hätte Soziale Arbeit als Gesprächspartner*in: Wäre sie zum Beispiel ein besonders kritisches Gegenüber?
Hannes Wolf: Da sind wir noch zu sehr im Prozess, als dass ich das beantworten könnte. Uns fehlt derzeit noch die Orientierung innerhalb der Profession. Wir haben ganz klar das politische Mandat, die Menschenrechte und eine starke Ethik. Vor deren Hintergrund reflektieren wir alle gesellschaftlichen Entwicklungen wie die Digitalisierung oder politische Entscheidungsprozesse. Es gibt die »Arbeitskreise Kritischer Sozialer Arbeit (AKS)«, deren Anliegen ist ganz klar, die System- und Gesellschaftskritik mit zu transportieren.
Aber überwiegend erlebe ich in der Sozialen Arbeit einen eher gemäßigteren Ton. Der Wert, um den sich eine solche »Markensprache« der Sozialen Arbeit drehen würde, wäre vielleicht Dialogfähigkeit: »Wir wollen im Gespräch bleiben.« Verbunden mit der Sorge, dass in dem Moment, wo man zu kritisch oder konfrontativ ist und einen bestimmten Punkt überschreitet, die Kommunikation abbricht. Ich denke, wir wollen deutlich sein und Missstände klar benennen. Und trotzdem wollen wir auch Gesprächspartner sein und bleiben, um auch etwas zu bewirken.
Es bräuchte also eine Sprache, die die Menschen nicht durch einen kritischen Tonfall »überlastet«, sondern die Lust zu macht, sich mit sozialen Fragen zu beschäftigen?
Ja, und auch eine Sprache, die ein positives Selbstbild zeichnet. Soziale Arbeit kann was. Das sollten wir souverän herüberbringen – klar, fachlich und wissenschaftlich fundiert. So würden wir auch unsere Mitglieder stärken.
Hinter #dauerhaft systemrelevant steht auch die Überlegung, wie Soziale Arbeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden soll. Wie weit seid ihr in diesem Prozess?
Hannes Wolf: Noch ziemlich am Anfang. Das hängt auch damit zusammen, dass der DBSH rein ehrenamtlich organisiert ist. Wir haben wenig Ressourcen für Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit und kommunizieren viel öfter reaktiv, als uns proaktiv mit Themen an die Öffentlichkeit zu wenden.
Es ist aber tatsächlich ein Ziel der Kampagne, unsere Corporate Identity als Profession weiterzuentwickeln. Dafür gilt es, zu klären, welches Bild von Sozialer Arbeit wir in den nächsten Jahren zeichnen wollen. Aktuell laufen wir da in zu viele Richtungen gleichzeitig. Eine wesentliche Frage ist: Welches Bild von Sozialer Arbeit vermitteln wir Politik und Verwaltung gegenüber? Wollen wir die »moderierende Fachexpertise« sein? Oder politisches Sprachrohr im Sinne von »Kampfrhetorik«. Wie man kommuniziert, so wird man wahrgenommen.
Manche Unternehmen entwickeln im Zuge einer »Corporate Identity« auch eine eigene Markensprache. Auf welchen Werten müsste eine Markensprache der Sozialen Arbeit aufbauen? Welchen Charakter hätte Soziale Arbeit als Gesprächspartner*in: Wäre sie zum Beispiel ein besonders kritisches Gegenüber?
Hannes Wolf: Da sind wir noch zu sehr im Prozess, als dass ich das beantworten könnte. Uns fehlt derzeit noch die Orientierung innerhalb der Profession. Wir haben ganz klar das politische Mandat, die Menschenrechte und eine starke Ethik. Vor deren Hintergrund reflektieren wir alle gesellschaftlichen Entwicklungen wie die Digitalisierung oder politische Entscheidungsprozesse. Es gibt die »Arbeitskreise Kritischer Sozialer Arbeit (AKS)«, deren Anliegen ist ganz klar, die System- und Gesellschaftskritik mit zu transportieren.
Aber überwiegend erlebe ich in der Sozialen Arbeit einen eher gemäßigteren Ton. Der Wert, um den sich eine solche »Markensprache« der Sozialen Arbeit drehen würde, wäre vielleicht Dialogfähigkeit: »Wir wollen im Gespräch bleiben.« Verbunden mit der Sorge, dass in dem Moment, wo man zu kritisch oder konfrontativ ist und einen bestimmten Punkt überschreitet, die Kommunikation abbricht. Ich denke, wir wollen deutlich sein und Missstände klar benennen. Und trotzdem wollen wir auch Gesprächspartner sein und bleiben, um auch etwas zu bewirken.
Es bräuchte also eine Sprache, die die Menschen nicht durch einen kritischen Tonfall »überlastet«, sondern die Lust zu macht, sich mit sozialen Fragen zu beschäftigen?
Ja, und auch eine Sprache, die ein positives Selbstbild zeichnet. Soziale Arbeit kann was. Das sollten wir souverän herüberbringen – klar, fachlich und wissenschaftlich fundiert. So würden wir auch unsere Mitglieder stärken.
Von Massenmedien zu digitaler Transparenz: Evolution der Öffentlichkeitsarbeit Sozialer Arbeit
Nochmal zurück in die 1970er-Jahre: Wie hat sich deiner Meinung nach die Öffentlichkeitsarbeit Sozialer Arbeit seit den Bergneustädter Gesprächen verändert?
Hannes Wolf: Ich glaube, seit den Bergneustädter Gesprächen hat sowohl innerhalb der Massenmedien als auch in der Sozialen Arbeit eine wichtige ethische Reflexion stattgefunden: »Was ist okay, wenn ich über Menschen berichte? Wie mache ich Fotos? Wie kann ich sensible Themen wie Wohnungslosigkeit oder Behinderung medial darstellen, ohne die Würde der Betroffenen zu verletzen? Wie gelingt es, Emotionen anzusprechen und gleichzeitig mit denen, über die ich spreche, auf Augenhöhe zu bleiben?« Dazu ist heute ein grundsätzliches Wissen und ein gewisser Konsens da. Das heißt, wir können uns heute in der Auseinandersetzung zwischen Massenmedien und Sozialer Arbeit jetzt anderen Fragen zuwenden.
Als Soziale Arbeit lernen wir gerade, mit der digitalen Welt umzugehen, die ja nicht nur neutral ist. Wir haben zum Beispiel mit der Hasskriminalität im Netz zu tun. Hier entstehen neue Arbeitsfelder wie digitales Streetwork.
Das Digitale ist zum festen Bestandteil unserer Lebenswelt geworden und es wird auf einmal sehr professionell Soziale Arbeit im digitalen Raum gemacht. Viele Schulsozialarbeiter*innen sind zum Beispiel während der Lockdown-Zeit über Insta-Accounts ganz selbstverständlich mit ihren Jugendlichen in Kontakt geblieben. Hier ist Soziale Arbeit plötzlich von ganz allein für die Öffentlichkeit sichtbar, zumindest transparent. So bekommt man nun auch die leiseren Töne eher zu hören, ohne von einer Zeitung abhängig zu sein. Jede*r Einzelne hat ihr*sein Telefon dabei und kann sehr laut werden. Ich glaube, die vorherige Trennung zwischen Sozialer Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit wird dadurch aufgehoben und die beiden Arbeitsbereiche verschmelzen miteinander.
Nachlesen?
Die Bergneustädter Gespräche ist als Publikation vergriffen, kann jedoch in Unibibliotheken geliehen werden. Ein Auszug daraus – die Bergneustädter Thesen – findest du im Buch »Klappern gehört zum Handwerk« von Ria Puhl.