
Daniel Nölleke hat über »Experten im Journalismus« promoviert.
Wie werden Sozialarbeiter zu Experten im Journalismus?
Der Kommunikationswissenschaftler Daniel Nölleke hat über Experten im Journalismus promoviert. Sozialarbeiter*innen rät er zu einer »professionellen, persönlichen Öffentlichkeitsarbeit«.
Herr Nölleke, wenn es um soziale Probleme geht, werden im Journalismus viel öfter Juristen, Mediziner und Soziologen präsentiert als Sozialarbeiter*innen – jedenfalls nehmen viele das so wahr. »Taugen« Sozialarbeiter nicht als Experten im Journalismus?
Daniel Nölleke: Doch, aus meiner Perspektive »taugen« sie eindeutig. Was Sozialarbeiter auszeichnet, ist doch ein sehr konkretes, handlungsbezogenes Wissen für spezifische Situationen. Für das journalistische Verständnis von Expertentum ist das sogar ganz idealtypisch.
Die Frage ist vielmehr die der Anerkennung. Kompetenz wird oft noch über abstrakte Titel signalisiert. In gewisser Weise ist es ein Verkürzungseffekt: Sobald jemand einen akademischen Titel hat oder sich vor einem Bücherregal aufstellt, in dem schlaue Texte drinstehen, wirkt das nach außen kompetenter.
Dabei ist Soziale Arbeit durchaus wissenschaftlich fundiert. Es gibt sogar eine eigene »Sozialarbeitswissenschaft«. Viele frühere Fachhochschulen nennen sich heute Hochschulen. Wird das von Journalist*innen nicht wahrgenommen?
Ich würde tatsächlich vermuten, dass das noch eine Weile dauert, bis es wahrgenommen wird – so wie bei vielen anderen Gesellschaftsbereichen, die sich akademisieren. Ehe Journalisten ihrem Publikum das als Expertise verkaufen können, gibt es oft ein gewisses »Time Gap«.
Sind akademische Titel wichtig, damit jemand als Expert*in gelten kann?
Nein, das würde ich so nicht sagen. In der Wissenssoziologie versteht man eine akademische Karriere zwar vielfach als Voraussetzung für eine Karriere als Experte. Aber man sieht ja, dass akademische Experten oft weltfremd sind und sich Probleme in der Praxis ganz anders darstellen, als in der Theorie. Das führt dazu, dass sich der Expertenbegriff auch in der wissenschaftlichen Debatte immer stärker öffnet – sowohl für Betroffene, die Experten ihrer eigenen Lebensumstände sind, als auch für Praktiker. Weder die aktuelle theoretische Diskussion rund um das Expertenverständnis noch das journalistische Expertenverständnis sprechen also dafür, dass Sozialarbeiter*innen per se exkludiert wären, oder dass Journalist*innen sich nur auf Akademiker*innen fokussieren müssten.

Herr Nölleke, wenn es um soziale Probleme geht, werden im Journalismus viel öfter Juristen, Mediziner und Soziologen präsentiert als Sozialarbeiter*innen – jedenfalls nehmen viele das so wahr. »Taugen« Sozialarbeiter nicht als Experten im Journalismus?
Daniel Nölleke: Doch, aus meiner Perspektive »taugen« sie eindeutig. Was Sozialarbeiter auszeichnet, ist doch ein sehr konkretes, handlungsbezogenes Wissen für spezifische Situationen. Für das journalistische Verständnis von Expertentum ist das sogar ganz idealtypisch.
Die Frage ist vielmehr die der Anerkennung. Kompetenz wird oft noch über abstrakte Titel signalisiert. In gewisser Weise ist es ein Verkürzungseffekt: Sobald jemand einen akademischen Titel hat oder sich vor einem Bücherregal aufstellt, in dem schlaue Texte drinstehen, wirkt das nach außen kompetenter.
Dabei ist Soziale Arbeit durchaus wissenschaftlich fundiert. Es gibt sogar eine eigene »Sozialarbeitswissenschaft«. Viele frühere Fachhochschulen nennen sich heute Hochschulen. Wird das von Journalist*innen nicht wahrgenommen?
Ich würde tatsächlich vermuten, dass das noch eine Weile dauert, bis es wahrgenommen wird – so wie bei vielen anderen Gesellschaftsbereichen, die sich akademisieren. Ehe Journalisten ihrem Publikum das als Expertise verkaufen können, gibt es oft ein gewisses »Time Gap«.
Sind akademische Titel wichtig, damit jemand als Expert*in gelten kann?
Nein, das würde ich so nicht sagen. In der Wissenssoziologie versteht man eine akademische Karriere zwar vielfach als Voraussetzung für eine Karriere als Experte. Aber man sieht ja, dass akademische Experten oft weltfremd sind und sich Probleme in der Praxis ganz anders darstellen, als in der Theorie. Das führt dazu, dass sich der Expertenbegriff auch in der wissenschaftlichen Debatte immer stärker öffnet – sowohl für Betroffene, die Experten ihrer eigenen Lebensumstände sind, als auch für Praktiker. Weder die aktuelle theoretische Diskussion rund um das Expertenverständnis noch das journalistische Expertenverständnis sprechen also dafür, dass Sozialarbeiter*innen per se exkludiert wären, oder dass Journalist*innen sich nur auf Akademiker*innen fokussieren müssten.

»Wenn ich über Heidi Klum schreibe, brauche ich jemanden, der Heidi Klum kennt.«
Das »Netzwerk Recherche« hat eine Checkliste für die Suche von Experten im Journalismus herausgegeben. Diese berücksichtigt eine wissenschaftliche Publikationsliste durchaus …
Das »Netzwerk Recherche« ist eine stark normative Einrichtung, die sich einem sehr guten, investigativen Journalismus verschrieben hat. Die Frage ist, um welchen Bereich es geht: Natürlich sollte im Wissenschaftsjournalismus die Zahl der Fachpublikationen eine Rolle spielen – nicht aber, wenn ich über die Schwangerschaft von Heidi Klum schreibe. Da brauche ich jemanden, der Heidi Klum kennt. In der Hinsicht ist meine Expertendefinition breiter.

»Journalisten wägen nicht ab, wer auf einer Skala von 1 bis 10 am kompetentesten ist!«
Wenn ich mich medial als Expertin positionieren will, ist mein Auftreten dann wichtiger als mein Wissen oder das Fachgebiet, das ich vertrete?
Wissen – überlegenes Wissen – ist nur eine Komponente, wie Expertise konstruiert wird. Im Journalismus spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wie sehr jemand bereit ist, die Dinge »auf den Punkt« zu bringen. Dazu sind gerade Akademiker oft nicht bereit, weil sie sagen: Es ist doch viel komplexer, was ich hier mache. Sich in dieser Hinsicht medientauglich zu geben, erreichbar zu sein, eine professionelle, persönliche Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben … Da bin ich mir nicht so sicher, wie sehr Sozialarbeiter*innen dazu bereit sind.
Eine »professionelle persönliche Öffentlichkeitsarbeit«, was meinen Sie damit genau?
Es beginnt damit, dass ich über eine gut zu recherchierende Emailadresse erreichbar bin und die Mails regelmäßig checke. Diese Öffentlichkeitsarbeit müsste sehr stark personenbezogen sein – eben, indem ich mich auf den entsprechenden Websites mit Bild präsentiere und meine Kompetenzen darbiete. Vielleicht auch gleich schon knackige Statements, die zeigen, wofür ich stehe. Was man nicht unterschätzen sollte: Journalisten richten sich oft danach, wen sie zu einem Thema schon mal befragt haben, mit wem sie gute Erfahrungen gemacht haben. Wer einmal in diesem Zirkel drin ist, wird weiter gehypt. Das macht es für Personen schwierig, die versuchen, neu hinein zu kommen.
Sozialarbeiter*innen zum Beispiel?
Vielleicht. Wobei – auf RTL beispielsweise gibt es ja eine Sendung mit Streetworkern, auch andere Formate mit Sozialarbeitern fallen mir ein. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Leute auch in anderem Kontext um Rat oder Meinungen gebeten werden, weil sie in diesem Zirkel eben schon drin sind.
Vielleicht ist es ja auch einfach nur ein Gefühl, dass die Soziale Arbeit medial nicht genügend wahrgenommen wird. Gibt es das Gefühl auch in anderen Berufsgruppen?
Für ganze Berufsgruppen kann ich das nicht beantworten. Aber auf jeden Fall fühlen viele Menschen sich persönlich nicht wahrgenommen. Man erwischt sich schnell dabei, dass man denkt: „Da sitzt nun ein Experte, der sich viel weniger auskennt, als ich. Warum fragen die nicht mich?“ So funktioniert Journalismus aber nicht. Journalisten wägen nicht ab, wer auf einer Skala von eins bis zehn am kompetentesten ist. Andere Dinge spielen zumindest auch eine Rolle. Um auf die Frage zurückzukommen: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dieses Gefühl auch auf Professionsebene gibt – gerade bei Professionen, denen der paternalistische Expertenduktus ursprünglich fehlt: »Ich sage euch jetzt mal, wo es lang geht…«
In der Sozialen Arbeit gibt es mehr Frauen als Männer. Kann das ein Grund dafür sein, dass es weniger Experten gibt?
Das Expertentum ist ganz klar ein sehr maskulin dominiertes Gewerbe. Es gibt in Deutschland nur wenige bekannte Expertinnen, wie etwa die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert, die als Energie-Expertin oft gehört wird.
Das heißt aber nicht, dass Journalisten Expertinnen ablehnen würden. Ich habe noch nie einen Journalisten etwas Derartiges sagen hören. Vermutlich orientieren sie sich bei der Suche nach Experten an den Strukturen, die wir alle vorfinden – zum Beispiel an hierarchischen Positionen in Organisationen. Und wenn wir uns mal auf die Wissenschaft konzentrieren, finden wir auf Hochschullehrerebene viel mehr Männer, als Frauen.
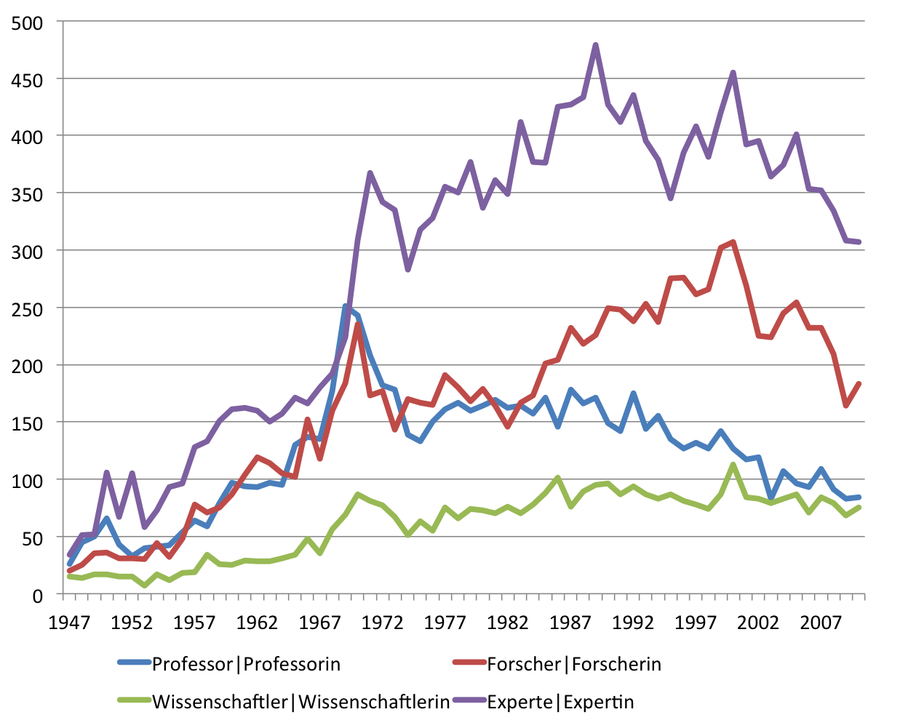
Wenn ich mich medial als Expertin positionieren will, ist mein Auftreten dann wichtiger als mein Wissen oder das Fachgebiet, das ich vertrete?
Wissen – überlegenes Wissen – ist nur eine Komponente, wie Expertise konstruiert wird. Im Journalismus spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wie sehr jemand bereit ist, die Dinge »auf den Punkt« zu bringen. Dazu sind gerade Akademiker oft nicht bereit, weil sie sagen: Es ist doch viel komplexer, was ich hier mache. Sich in dieser Hinsicht medientauglich zu geben, erreichbar zu sein, eine professionelle, persönliche Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben … Da bin ich mir nicht so sicher, wie sehr Sozialarbeiter*innen dazu bereit sind.
Eine »professionelle persönliche Öffentlichkeitsarbeit«, was meinen Sie damit genau?
Es beginnt damit, dass ich über eine gut zu recherchierende Emailadresse erreichbar bin und die Mails regelmäßig checke. Diese Öffentlichkeitsarbeit müsste sehr stark personenbezogen sein – eben, indem ich mich auf den entsprechenden Websites mit Bild präsentiere und meine Kompetenzen darbiete. Vielleicht auch gleich schon knackige Statements, die zeigen, wofür ich stehe. Was man nicht unterschätzen sollte: Journalisten richten sich oft danach, wen sie zu einem Thema schon mal befragt haben, mit wem sie gute Erfahrungen gemacht haben. Wer einmal in diesem Zirkel drin ist, wird weiter gehypt. Das macht es für Personen schwierig, die versuchen, neu hinein zu kommen.
Sozialarbeiter*innen zum Beispiel?
Vielleicht. Wobei – auf RTL beispielsweise gibt es ja eine Sendung mit Streetworkern, auch andere Formate mit Sozialarbeitern fallen mir ein. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Leute auch in anderem Kontext um Rat oder Meinungen gebeten werden, weil sie in diesem Zirkel eben schon drin sind.
Vielleicht ist es ja auch einfach nur ein Gefühl, dass die Soziale Arbeit medial nicht genügend wahrgenommen wird. Gibt es das Gefühl auch in anderen Berufsgruppen?
Für ganze Berufsgruppen kann ich das nicht beantworten. Aber auf jeden Fall fühlen viele Menschen sich persönlich nicht wahrgenommen. Man erwischt sich schnell dabei, dass man denkt: „Da sitzt nun ein Experte, der sich viel weniger auskennt, als ich. Warum fragen die nicht mich?“ So funktioniert Journalismus aber nicht. Journalisten wägen nicht ab, wer auf einer Skala von eins bis zehn am kompetentesten ist. Andere Dinge spielen zumindest auch eine Rolle. Um auf die Frage zurückzukommen: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dieses Gefühl auch auf Professionsebene gibt – gerade bei Professionen, denen der paternalistische Expertenduktus ursprünglich fehlt: »Ich sage euch jetzt mal, wo es lang geht…«
In der Sozialen Arbeit gibt es mehr Frauen als Männer. Kann das ein Grund dafür sein, dass es weniger Experten gibt?
Das Expertentum ist ganz klar ein sehr maskulin dominiertes Gewerbe. Es gibt in Deutschland nur wenige bekannte Expertinnen, wie etwa die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert, die als Energie-Expertin oft gehört wird.
Das heißt aber nicht, dass Journalisten Expertinnen ablehnen würden. Ich habe noch nie einen Journalisten etwas Derartiges sagen hören. Vermutlich orientieren sie sich bei der Suche nach Experten an den Strukturen, die wir alle vorfinden – zum Beispiel an hierarchischen Positionen in Organisationen. Und wenn wir uns mal auf die Wissenschaft konzentrieren, finden wir auf Hochschullehrerebene viel mehr Männer, als Frauen.
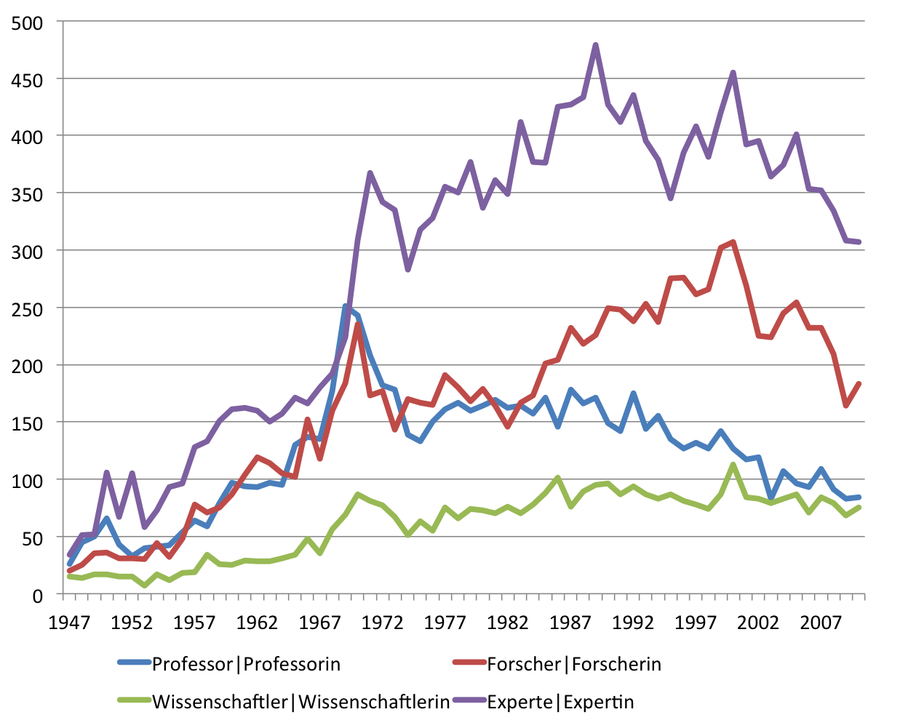
»Viele Geschichten funktionieren gar nicht ohne Experten!«
Angenommen, ein Berufsverband für Soziale Arbeit will künftig mehr Expertise in der Pressearbeit anbieten. Geht das überhaupt? Oder sind es doch vielmehr die Journalist*innen, die entscheiden, wer Expert*in wird?
Letztlich sitzt der Journalismus hier am längeren Hebel und entscheidet, wen er als Experten rekrutiert. Ich bin aber überzeugt, dass das zu forcieren ist und dass es mit dem Wissen, wie Journalismus funktioniert, gelingen kann. Überhaupt halte ich das Anbieten von Expertise für ein bisher sehr unterschätztes Element von Öffentlichkeitsarbeit. Wissenschaftliche Daten zeigen, dass Journalisten sehr oft auf Expertenstimmen angewiesen sind.
Viele »Geschichten« laufen überhaupt nicht, wenn ein Experte fehlt – selbst wenn der gar nichts zu sagen hat. »Da fehlt ein Experte«, heißt es dann in der Redaktion. Journalisten haben also einen viel konkreteren Bedarf nach Experten als nach allgemeineren PR-Stücken. Wenn man sich da professionell präsentiert, kann man nicht nur sich selbst, sondern auch seine Organisation und die Profession prominent im Journalismus platzieren.
Angenommen, ich bin Sozialarbeiterin in einer Suchtberatungsstelle. Wie gehe ich vor, um Expertin zu werden?
Zuerst müssen Sie bei Journalist*innen bekannt werden. Natürlich rufen Sie da nicht einfach an und sagen: Hier bin ich! Sondern Sie schauen: Gibt es ein aktuelles Thema, in dem ich kompetent bin, womit ich andocken kann?
Universitäten machen das ständig. Ein Stichwort ist die Fussball-WM 2014 in Brasilien. Da stellt eine Uni zum Beispiel 20 Experten: Einer kennt sich mit Südamerika aus, einer mit Entwicklungspolitik, einer mit dem Heimvorteil im Fussball und so weiter. So kommen Wissenschaftler über Expert*innen-Angebote in die Medien. Für einzelne Sozialarbeiter*innen ist das natürlich schwieriger, ohne PR-Stelle im Rücken, aber es ist ein Ansatzpunkt.
Was ist mit Google?
Die Suchmaschinenoptimierung sollte man nicht vergessen, denn Journalisten suchen oft auf diesem Weg nach Experten. Viele Homepages, die ich aus der Sozialen Arbeit kenne, sind relativ »unprofessionell« in dem Sinne, dass sie sich nur an die Klientel richten. Wenn man eine größere Öffentlichkeit erreichen will, sollten auch Kontaktdaten und Informationen zu den jeweiligen Themen sollten da sein. Ich habe keinen Königsweg parat, wie man Expert*in wird, aber diese Dinge gehören dazu. Und dass man Bereitschaft zeigt, wenn man dann mal angerufen wird!
Ist das Expertentum im Lokaljournalismus auch wichtig?
Weniger. Der Lokaljournalismus ist stark auf Termine und Protagonisten bezogen. Expert*innen sind da eher Anlässe von Berichterstattung. Natürlich kann eine Suchtberatungsstelle ein Thema generieren und zum Beispiel eine Ausstellung machen – dann berichten auch die Medien. Wirkliche Expert*innen kommen aber eher bei Themen zu Wort, die latent in der Luft liegen, die aktuell, aber weiter entfernt sind, und die einer Einordnung bedürfen.
Andererseits kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Experte gerade den »lokalen Touch« ausmacht. Nehmen wir als Beispiel wieder die Fussball-WM 2014: Die betrifft das Lokale zunächst zwar gar nicht. Aber vielleicht gibt es da jemanden, der sich mit dem Leben in Favelas extrem gut auskennt, weil er – zum Beispiel – als Sozialarbeiter in Brasilien war. Das wäre ein Experte!
Ist es möglich, als soziale Organisation zu sagen: Wir wollen keinen Bericht über unser Sommerfest, sondern unsere Expertise einbringen – und deshalb bieten wir als Rotes Kreuz meinetwegen der Lokalzeitung einen Service-Artikel »Richtig Blutspenden« an?
Das könnte sicherlich klappen, denn der Beratungsaspekt spielt eine große Rolle, was Experten im Journalismus angeht. Drei Fragen, drei kurze Antworten zum Thema: „Wie schütze ich meine Kinder vor Neonazi-Liedgut auf dem Schulhof?“ – mit solchen Angeboten kann man sicher gut im Lokaljournalismus landen. Und man kann es prima selbst vorbereiten.
Wie ist es mit dem Selbstvertrauen? Muss ich als Medien-Expert*in geboren sein? Oder kann ich es trainieren?
Ich bin sehr sicher, dass man es extrem gut schulen kann. Und muss. Vielleicht gibt es einige Naturtalente, aber die allermeisten Menschen müssen sich im Umgang mit Medien irgendwie verbiegen. Es gibt Medientrainings für Wissenschaftler, Sportler, Juristen – da geht es letztlich immer um Expertentum: Wie schaffe ich es, meinen Forschungsbereich in 30 Sekunden auf den Punkt zu bringen? Natürlich kann man das auch für Sozialarbeiter*innen machen.
Angenommen, ein Berufsverband für Soziale Arbeit will künftig mehr Expertise in der Pressearbeit anbieten. Geht das überhaupt? Oder sind es doch vielmehr die Journalist*innen, die entscheiden, wer Expert*in wird?
Letztlich sitzt der Journalismus hier am längeren Hebel und entscheidet, wen er als Experten rekrutiert. Ich bin aber überzeugt, dass das zu forcieren ist und dass es mit dem Wissen, wie Journalismus funktioniert, gelingen kann. Überhaupt halte ich das Anbieten von Expertise für ein bisher sehr unterschätztes Element von Öffentlichkeitsarbeit. Wissenschaftliche Daten zeigen, dass Journalisten sehr oft auf Expertenstimmen angewiesen sind.
Viele »Geschichten« laufen überhaupt nicht, wenn ein Experte fehlt – selbst wenn der gar nichts zu sagen hat. »Da fehlt ein Experte«, heißt es dann in der Redaktion. Journalisten haben also einen viel konkreteren Bedarf nach Experten als nach allgemeineren PR-Stücken. Wenn man sich da professionell präsentiert, kann man nicht nur sich selbst, sondern auch seine Organisation und die Profession prominent im Journalismus platzieren.
Angenommen, ich bin Sozialarbeiterin in einer Suchtberatungsstelle. Wie gehe ich vor, um Expertin zu werden?
Zuerst müssen Sie bei Journalist*innen bekannt werden. Natürlich rufen Sie da nicht einfach an und sagen: Hier bin ich! Sondern Sie schauen: Gibt es ein aktuelles Thema, in dem ich kompetent bin, womit ich andocken kann?
Universitäten machen das ständig. Ein Stichwort ist die Fussball-WM 2014 in Brasilien. Da stellt eine Uni zum Beispiel 20 Experten: Einer kennt sich mit Südamerika aus, einer mit Entwicklungspolitik, einer mit dem Heimvorteil im Fussball und so weiter. So kommen Wissenschaftler über Expert*innen-Angebote in die Medien. Für einzelne Sozialarbeiter*innen ist das natürlich schwieriger, ohne PR-Stelle im Rücken, aber es ist ein Ansatzpunkt.
Was ist mit Google?
Die Suchmaschinenoptimierung sollte man nicht vergessen, denn Journalisten suchen oft auf diesem Weg nach Experten. Viele Homepages, die ich aus der Sozialen Arbeit kenne, sind relativ »unprofessionell« in dem Sinne, dass sie sich nur an die Klientel richten. Wenn man eine größere Öffentlichkeit erreichen will, sollten auch Kontaktdaten und Informationen zu den jeweiligen Themen sollten da sein. Ich habe keinen Königsweg parat, wie man Expert*in wird, aber diese Dinge gehören dazu. Und dass man Bereitschaft zeigt, wenn man dann mal angerufen wird!
Ist das Expertentum im Lokaljournalismus auch wichtig?
Weniger. Der Lokaljournalismus ist stark auf Termine und Protagonisten bezogen. Expert*innen sind da eher Anlässe von Berichterstattung. Natürlich kann eine Suchtberatungsstelle ein Thema generieren und zum Beispiel eine Ausstellung machen – dann berichten auch die Medien. Wirkliche Expert*innen kommen aber eher bei Themen zu Wort, die latent in der Luft liegen, die aktuell, aber weiter entfernt sind, und die einer Einordnung bedürfen.
Andererseits kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Experte gerade den »lokalen Touch« ausmacht. Nehmen wir als Beispiel wieder die Fussball-WM 2014: Die betrifft das Lokale zunächst zwar gar nicht. Aber vielleicht gibt es da jemanden, der sich mit dem Leben in Favelas extrem gut auskennt, weil er – zum Beispiel – als Sozialarbeiter in Brasilien war. Das wäre ein Experte!
Ist es möglich, als soziale Organisation zu sagen: Wir wollen keinen Bericht über unser Sommerfest, sondern unsere Expertise einbringen – und deshalb bieten wir als Rotes Kreuz meinetwegen der Lokalzeitung einen Service-Artikel »Richtig Blutspenden« an?
Das könnte sicherlich klappen, denn der Beratungsaspekt spielt eine große Rolle, was Experten im Journalismus angeht. Drei Fragen, drei kurze Antworten zum Thema: „Wie schütze ich meine Kinder vor Neonazi-Liedgut auf dem Schulhof?“ – mit solchen Angeboten kann man sicher gut im Lokaljournalismus landen. Und man kann es prima selbst vorbereiten.
Wie ist es mit dem Selbstvertrauen? Muss ich als Medien-Expert*in geboren sein? Oder kann ich es trainieren?
Ich bin sehr sicher, dass man es extrem gut schulen kann. Und muss. Vielleicht gibt es einige Naturtalente, aber die allermeisten Menschen müssen sich im Umgang mit Medien irgendwie verbiegen. Es gibt Medientrainings für Wissenschaftler, Sportler, Juristen – da geht es letztlich immer um Expertentum: Wie schaffe ich es, meinen Forschungsbereich in 30 Sekunden auf den Punkt zu bringen? Natürlich kann man das auch für Sozialarbeiter*innen machen.
Du selbst trittst öffentlich als Experte für Sucht auf, zum Beispiel in deinem Podcast »Sozifon«.
Richtig, ich werde auch immer wieder für Podiumsdiskussionen etcetera angefragt. Man weiß ja, dass es so läuft: Die Veranstalter brauchen einen ehemaligen Suchtkranken, der seine Story erzählt, und mein Name taucht im Netz schon auf. Lange habe ich das gern gemacht.
Aber allmählich merke ich, dass ich einen emotionalen Preis zahle. Wieso muss ich mir das antun? Es ist scheißegal, ob du einen Bachelor hast oder einen Master – du trittst dann nur als ehemaliger Suchtkranker auf. Dabei ist die Sucht nicht mein Alleinstellungsmerkmal, sie gibt nicht meine Kompetenz wieder. Ich bin in anderen Sachen eher Experte, als in dem.
Nervt es dich?
Nein, es nervt nicht. Es ist mein Lebensthema. Aber nicht die Sucht, sondern die Frage: Was steht dahinter? Was hat mich zum Trinken gebracht? Am liebsten beschäftige ich mich mit der Motivation. Denn wichtig ist, dass ich weiß, warum ich etwas tue. Warum ich jemanden schlecht behandle. Auch mich selbst.
Oder in meinem Fall: Warum ich mich von etwas abhängig mache – und wie es schaffe, unabhängig, selbständig zu sein, in vielen Beziehungen. Das ist die Verbindung zu meiner Arbeit. Es lassen sich daraus gute Parallelen ziehen, genauso wie aus der Wissenschaft.
A propos Parallelen: Ich habe einen Bekannten, der Rollstuhl fährt und immer wieder erzählt, welche absurden Begegnungen er durch seine Behinderung macht. Bei mir ist das Alleinerziehen sehr präsent, da trifft man auch auf Vorurteile und die ein oder andere Behinderung. Wir beide haben im Spaß mal überlegt, gemeinsam über unsere Erfahrungen ein Buch zu schreiben. Wärst du auch dabei?
Ja, das ist eine gute Idee. Komm, lass uns ein Buch schreiben! Die Themen sind durchaus vergleichbar. Als ich im letzten Jahr mit meinem Podcast begonnen habe, genoss ich es regelrecht, dass das Thema Sucht wieder in mein Leben kam. Wenn man täglich podcastet, kann man die Themen ja nicht tief behandeln. Aber mit der Sucht als Anreißer konnte ich viele Querverbindungen herstellen. Das hat zu einem gewissen Erfolg beigetragen. Manche Menschen hat es verwirrt, dass ich so offen damit umging. Ich wohne ja hier im konservativen Oberschwaben und war auch Arbeitgebern gegenüber immer sehr offen. Die wussten in Honorarverträgen oft gar nicht, wie sie damit umgehen sollten. Aber für mich ist das wichtig: Zu sagen, wer ich bin.
Ich will nicht süchtig sein, das ist ein spürbares Defizit. Aber ich bin es nunmal. Und ich kann es für mich selbst nutzbringend und positiv einsetzen. Dass ich das sagen, schreiben oder in ein Podcast verpacken kann, dass ich der Welt meine Botschaft vermitteln kann – das ist doch ein Geschenk!
»Experten im Journalismus« – das Buch
Das Buch »Experten im Journalismus« von Dr. Daniel Nölleke ist hier erhältlich: zum Buch.




[…] Expertise zeigen in den Massenmedien – so geht’s […]